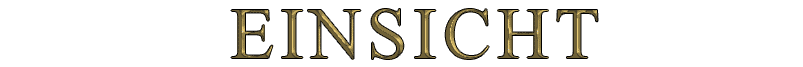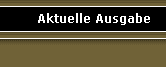Der heilige Anselm von Canterbury
von
Eugen Golla
Daß wir über das gesamte Leben dieses großen Heiligen des
Hochmittelalters so gut informiert sind, verdanken wir in erster Linie
seinem Sekretär Eadmer.
Anselm wurde im Jahre 1033 im piemontesischen Aosta als Sohn einer
Adelsfamilie geboren. Schon früh zeigte sich bei ihm die -
wahrscheinlich mütterlicherseits ererbte - mit Sanftmut verbundene,
hohe Intelligenz durch Freude und Eifer am Lernen. Allerdings führte
die Behandlung durch einen brutalen Pädagogen, der ihn, um seine
Fortschritte noch zu beschleunigen, einsperrte, zu einer seelischen
Krise. Nachdem er diese überstanden hatte, wurde er von seiner Mutter
einem in der Nähe gelegenen Benediktinerkloster anvertraut, wo er nicht
nur überraschende Fortschritte im Lernen machte, sondern auch sein
Interesse am klösterlichen Leben geweckt wurde.
Aber der Vater hatte für diese Neigung des inzwischen fünfzehn Jahre
alten Anselm kein Verständnis; denn er wollte, daß sein einziger Sohn
auch der Erbe seines Namens und seiner Güter werden sollte. Um dies zu
erreichen, versuchte er, die religiösen Gefühle seines Sohnes durch die
Verlockung zu einem lasterhaften Leben zu ersticken. Gebet und
Warnungen der Mutter vermochten es zwar, das Schlimmste zu verhüten,
aber als Anselm sein zwanzigstes Lebensjahr erreicht hatte, starb
sie.
Nun hatte der Vater freie Hand, seinem Zorn, ja Haß gegen Anselm freien
Lauf zu lassen. Da gab es für ihn nur ein Mittel: Heimat und Vaterhaus
zu verlassen. Begleitet von einem Diener und einem Esel, der einige
Lebensmittel trug, überstieg er den Mont Cenis. Aber diese Strapazen
sollten nicht nur vorübergehend sein; denn es vergingen drei Jahre, bis
er nach dem Umherwandern in Burgund und Frankreich eine Stätte fand,
die ihn zum Bleiben einlud: die erst kurz zuvor errichtete Abtei Bec in
der Normandie. Mit Feuereifer widmete er sich dort wiederum dem
Studium, wobei er sämtliche Mitschüler übertraf. Sein Lehrer war kein
geringerer als Lanfranc, einer der berühmten Theologen seiner Zeit.
Dieser hatte sich besonders ausgezeichnet durch die Verteidigung der
katholischen Lehre vom Abendmahl, die von Berengar von Tours in
häretischer Absicht bekämpfte wurde, der öffentlich die Eucharistie nur
für ein Symbol des Leibes und Blutes Christi erklärt hatte.
Durch das Leben im Kloster fühlte sich Anselm mehr und mehr zu dem
monastischen Leben hingezogen. Bald legte er die Gelübde ab, um ein
Mönch nach der Regel des hl. Benedikt zu werden, so daß er innerhalb
weniger Jahre zum Priester geweiht werden konnte.
Als 1063 Lanfranc zum Abt von St. Stephan in Caen abberufen worden war,
übernahm Anselm, obwohl erst dreißig Jahre alt, das Amt des Priors.
Seine tiefe und warmherzige Frömmigkeit, die ihn aber nicht hinderte,
auch fest und bestimmt aufzutreten, aber nicht minder sein
pädagogisches Geschick bewirkten, daß ihn bald alte und junge Mönche
schätzten, obwohl erstere es anfangs schwer ertrugen, bei der Wahl zum
Prior übergangen worden zu sein.
Seine Liebe zur Wissenschaft bewog Anselm, einst seinen väterlichen
Freund, den Erzbischof Maurille von Rouen, um Rat zu fragen, ob er
nicht auf sein Amt verzichten solle, um sich in klösterlicher Stille
ganz dem Studium und der Meditation widmen zu können. Aber der
Prälat legte ihm nahe, sich dem Dienst am Nächsten nicht zu
entziehen, denn er habe oft erfahren, daß diejenigen, welche sich
weigerten, für die anderen zu arbeiten, um in Ruhe leben zu können, von
dem einem Übel in ein noch größeres gefallen seien.
Im Jahre 1093 wurde Anselm Nachfolger von Lanfranc, welcher seit 1070
Erzbischof von Canterbury gewesen war. Anselm war sich bewußt, welche
Sorgen und Kämpfe er als Primas von England zu erwarten hatte, da
dieses Land, obwohl formell gesehen, ein Lehensstaat war, in
Wirklichkeit aber eine straffe Zentralgewalt besaß, die auch das
Kirchengut zu Ritterlehen mit genauer Dienst-pflicht machte. Der König,
Wilhelm der Rote, neigte zudem dazu, die Freiheiten der Kirche zu
beschneiden, insbesondere dadurch, daß er die erledigten Bischofssitze
zu besetzen verbot, um ihre Einkünfte zu genießen. Da Anselm der
Beseitigung all dieser Mißstände nicht gewachsen zu sein glaubte, begab
er sich, oder bessser gesagt, floh er 1097 nach Rom, um von Papst Urban
II., dem Papst des ersten Kreuzzugs, die Erlaubnis zu erhalten, in sein
Kloster zurückkehren zu dürfen. Dieser versprach ihm zwar seinen Schutz
und wandte sich in einem Brief an den König mit der ernsten Mahnung,
Anselm sämtliche Rechte zu gewähren, die seine Vorgänger innegehabt
hatten, aber er kam Anselms Bitte, abdanken zu dürfen, nicht nach.
Als der Papst ein Konzil nach Bari einberufen hatte, um die
Wiederveinigung der Kirche mit den Griechen zustandezubringen, mußte
Anselm teilnehmen. Mit welcher Gründlichkeit und Energie er die
katholische Lehre vom Ausgehen des Heiligen Geistes vom Vater und vom
Sohn vorbrachte, geht aus seiner Schrift "De processione Sancti
Spiritus" hervor. Das Vorhaben des Konzils, den König von England zu
exkommunizieren, konnte Anselm verhindern, indem er sich zu Füßen des
Papstes niederwarf und für seinen Verfolger um Nachsicht bat. Von Rom
begab sich Anselm wenig später nach Lyon, wo er vom Erzbischof mit
großen Ehren empfangen wurde. Während seines dortigen Aufenthalts
erfuhr er, daß König Wilhelm infolge eines Jagdunfalls unerwartet
gestorben war. Unter Tränen sprach er: "Ich zöge es vor, selbst tot zu
sein, als die Nachricht von einem solchen Ende ohne Beichte und Reue
erfahren zu müssen."
Der neue König, Heinrich I., - ein Bruder des vorigen - berief Anselm
nach England zurück und empfing ihn seinem Range gemäß mit großen
Ehren. Aber nur zu bald zerstörte der König das harmonische Verhältnis.
Obwohl auf der Synode zu Clermont 1095 die Laieninvestitur und die
Ablegung des Lehenseides seitens der Geistlichkeit verboten worden war,
verlangte Heinrich von Anselm die Ablegung des Eides der
Untertanentreue. Es kam zu keiner Einigung, zumal der neue Papst,
Paschalis II., hinsichtlich der Investituren nach der strengen
Disziplin Gregors VII. verfuhr. Für den papsttreuen Anselm war es sehr
schmerzlich, erfahren zu müssen, daß sich manche seiner
Mitbischöfe auf der gegnerischen Seite befanden. Schließlich schlug der
König ihm vor, zur Lösung des Problems nach Rom zu gehen, was in
Wirklichkeit einer Verbannung gleich kam, die drei Jahre dauern sollte,
und die er nicht nur in der Ewigen Stadt, sondern auch in Italien und
Frankreich verbrachte.
1106 lud der König ihn ein, nach England zurückzukehren, wo ein
Kompromiß geschlossen wurde: der König verzichtete auf die Investitur
mit Ring und Stab, während der Erzbischof zustimmte, die Konsekration
derer, welche den Lehenseid leisteten, nicht zu verweigern. Da der
Papst diejenigen, die vom König die Investitur erhalten hatten, von der
Exkommunikation lossprach, konnte 1107 der englische Investiturstreit,
der viel kürzer und einen geringeren Schaden als im deutschen Reich
angerichtet hatte, beendet werden.
Wie gut nun das Einvernehmen zwischen dem Erzbischof und dem König war,
geht auch daraus hervor, daß letzterer ihn 1108 vor seiner Reise in die
Normandie zum Reichsverweser ernannte. Aber daneben widmete sich Anselm
in den letzten Jahren seines Lebens der Reform des Klerus im Sinne der
vom Mönchstum geprägten Reformen Gregors VII. Insbesondere galt
sein Kampf den beiden Hauptsünden des Klerus, der Simonie und der
Unenthaltsamkeit. Wie vielseitig sein Wirken war, kann man schon daraus
ersehen, daß er sich auch bemühte, den König zur Unterdrückung der
Herstellung von Falschgeld zu bewegen. Neue Sorgen bedrückten ihn, als
der Erzbischof von York den Anspruch auf den Primatialsitz von England
erhob, der immer Canterbury zustand. Erst seinem Nachfolger war es
vergönnt, diesen Streit zugunsten Canterburys zu beenden.
Ein halbes Jahr vor seinem Tod am 21. April 1109 befiel ihn eine große
Schwäche, so daß er außerstande war, die hl. Messe zu feiern. Aber
täglich ließ er sich in eine Kapelle tragen, um an ihr teilzunehmen.
Beigesetzt wurde Anselm in seiner Kathedrale neben seinem Vorgänger
Lanfranc. Sein Fest, das am 21. April gefeiert wurde, wurde von Papst
Alexander VIII. auf die Gesamtkirche ausgedehnt, Klemens XI. erhob ihn
1720 zum Kirchenlehrer.
Anselm empfand nicht nur die Politik, sondern auch alle
organisatorischen Aufgaben, die mit einer geistlichen Würde verbunden
sind, als Last. Aber sein Pflichtgefühl befahl ihm, alles Unangenehme
im Gehorsam zu Gott zu tragen. Wie sehr die geistigen Dinge Gegenstand
seines Denkens waren, zeigte sich auch darin, daß er an den Mahlzeiten
nach Möglichkeit nur dann teilnahm, wenn geistliche Tischgespräche
stattfanden.
Eine unbestrittene Berühmtheit erlangte er als tieffrommer Bahnbrecher
auf dem Gebiet der mittelalterlichen Theologie. Meist wird er als Vater
der Scholastik bezeichnet, obwohl er keine eigene Schule gegründet
hatte, vielmehr sowohl in Bec als auch in Canterbury fast immer nur für
wenige Schüler schrieb. Aber auch die, welche ihm diesen Titel nicht
zuerkennen wollen, müssen zugeben, daß er einer der wichtigsten
Wegbereiter der Scholastik ist. Das Motto unserer Zeitschrift EINSICHT
"Credo ut intelligam" ("Ich glaube, damit ich einsehe") ist
programmatisch: Der Glaube an die geoffebarten Heilswahrheiten kann und
soll mittels wissenschaftlicher Erkenntnis zu tieferen Einsichten in
ihn geführt werden. Anselms Idee war es, Glauben und Vernunft zu
versöhnen: der Glaube muß vernünftig sein. Er legte einen Teil seiner
Werke dem Papst zur Beurteilung vor, jederzeit bereit, alles, was als
Irrtum erkannt worden wäre, zu widerrufen. Falls die Hl.Schrift mit
Beweisen aus der Vernunft einmal in (scheinbarem) Widerspruch stünde,
würde er dem Glauben folgen. Man kann annehmen, daß er genügend
Vertrauen hatte zu hoffen, auch Nicht-Christen und Atheisten mit dieser
seiner Methode zu gewinnen und sie im Glauben dann so zu festigen, daß
ihnen ihr Unglaube als widersinnig erschiene.
Sein vorerwähnter Schüler und Sekretär, Eadner berichtet, daß Anselm
sich einst bemühte, einen Satz zu finden, der zum Beweis alles dessen
ausreichte, was der Glaube über Gott und seine Attribute lehrt, und wie
dieses Suchen ihm nicht nur den Schlaf raubte, sondern ihm sogar als
eine Falle Satans erschien. In seiner Schrift "Proslogion" zeigt
er nach einem langen Gebet, daß der rechtmäßige Begriff des Wesens, das
als das größte gedacht werden kann, ineins die Erkenntnis der realen
Existenz dieses Wesens ist. Hierbei handelt es sich um den sog.
"Ontologischen Gottesbeweis", der aber nicht - wie vielfach
mißverstanden - vom Begriff Gottes auf dessen Existenz schließt,
sondern indem Gott eingesehen wird als derjenige, der den Denkakt,
durch den er vom Menschen als das "Größte" gedacht wird, im Vollzug
dieses Denkaktes unmittelbar rechtfertigt und deshalb real existiert.
Darum nennt Anselm Gott das "Größte", was gedacht werden kann. Von
Thomas von Aquin zu Unrecht getadelt, nahmen berühmte Theologen (vor
allem aus der Franziskanerschule) und Philosophen (z.B. Descartes und
Fichte) diesen Beweis - wenn auch mit manchen Änderungen - in ihr
System auf, der ohne Zwei£el einen bedeutenden Fortschritt in den Ideen
und Methoden seiner Zeit bedeutete.
Eines der bedeutendstes Werk Anselms ist der Dialog "Cur Deus homo"
("Weshalb Gott Mensch wurde") in welchem Anselm als Gesprächspartner
ein Nicht-Christen wählt. Die Lehre von der stellvertretenden
Genugtuung Christi für die Sünden der Menschen ist zwar bereits im
Alten und Neuen Testament klar ausgedrückt, z.B. in Isaias
prophetischem Wort über den leidenden Gottesknecht oder in dem
Ausruf Johannes des Täufers: "Sehet das Lamm Gottes, das hinwegnimmt
die Sünden der Welt", nach verschiedenen richtigen Teorien der
Kirchenväter gab es aber auch falsche, wie z. B. die des Origenes, der
eine unbiblische Loskauftheorie vertrat, weil der Teufel infolge der
Erbsünde ein förmliches Eigentums- und Herrschaftsrecht über den
Menschen besitze. In seiner Schrift entwickelte nun Anselm folgende
Lehre: Die Würde und Ehre Gottes verlangt nicht nur Rückerstattung,
sondern auch eine Genugtuung oder Bestrafung. Da aber Gottes
Barmherzigkeit eine Bestrafung, d.h. die Verdammung des nach den Engeln
höchsten Geschöpfes, des Menschen, nicht zuläßt, dieser aber für die
Größe seiner Schuld Sühne zu leisten außerstande ist, ergibt sich der
Schluß, daß zur Leistung der Sühne nur der fähig ist, wer Gott und
Mensch zugleich ist. Dieser vollbrachte schuldlos eine unendliche
Leistung. Deren Lohn war die Übertragung dieses Verdienstes auf die
Menschen, die an den Heiland glauben, die sich bemühen, Gottes Gebote
zu halten, und die diese unverdiente Leistung in Demut annehmen wollen.
Jedenfalls hat Anselm mit seiner Satisfakionstheorie die Grundlagen für
die Erlösungslehre des Konzils von Trient geliefert, wenn auch
kritische Stimmen an dieser - oberflächlich betrachtet - juristischen
Lösung Anstoß nahmen.
Wenn auch Anselm kein vollständiges Werk über die katholische Lehre
hinterließ, besitzen wir jedoch noch eine Anzahl anderer theologischer
Schriften, aber auch Gebete und Meditationen und vor allem einige
hundert Briefe, die uns einen wichtigen Aufschluß über seine
Persönlichkeit geben und sehr wichtig für die Kirchengeschichte
Englands sind.
Benützte Literatur:
Bartmann Bernhard: "Lehrbuch der Dogmatik", Bd. 1; Freiburg 1928.
"Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon", Bd. 1, Hamm 1975.
"Catholicisme - Hier-Aujourd'hui-Demain" Bd. 1, Paris 1948.
Heinzmann, Richard: "Anselm von Canterbury" in: "Klassiker der Theologie" Band 1, München 1981.
"New Catholic Encyclopedia", Bd. 1, Washington 1967.
Pohle-Gierens: "Dogmatik", Band 1 u. 2, Paderborn 1936/37.
"Vies des Saints", Band 4, Paris 1946.
Schurr, Adolf: "Die Begründung der Philosophie durch Anselm von Canterbury", Stuttgart 1966.
Mojsisch, Burkhart (Hrsg): "Kann Gottes Nicht-Sein gedacht werden? Die
Kontroverse zwischen Anselm von Canterbury und Gaunilo von Marmoutiers"
Mainz 1989.
Schrimpf, Gangolf: "Anselm von Canterbury. Proslogion II-IV. Gottesbeweis oder Widerlegung des Toren?" Frankfurt 1994.
Recktenwald, Engelbert: "Die ethische Struktur des Denkens von Anselm von Canterbury" Heidelberg 1998.
|