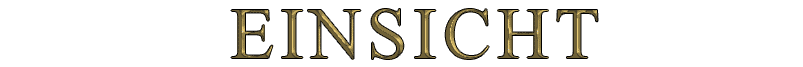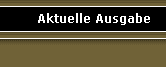Das Kreuz am Bosporus
von
Wilhelm Hünermann
Nach stürmischer Seefahrt läuft im August 1587 eine venezianische
Galione ins Marmarameer ein. Strahlend wölbt sich der wolkenlose Himmel
über der türkisblauen Flut und wirft seinen Glanz über die alte
byzantinische Kaiserstadt am Bosporus, die mit ihren goldenen Kuppeln,
den stolzen Palästen und den schneeweißen Minaretts wie ein
Märchentraum aus Tausend-und-einer-Nacht aus den Wassern
emporsteigt.
Da ist die Hagia Sophia, der Prachtbau des Kaisers Julian, einst eine
der herrlichsten und ehrwürdigsten Basiliken der Christenheit, nun aber
flankiert von vier schlanken Gebetstürmen, von denen fünfmal am Tag der
Lobpreis Allahs erschallt.
Dem armen Kapuziner an der Reling wird das Herz schwer bei ihrem
Anblick. Hundertvierunddreißig Jahre sind vergangen, seit Mohammed II.
die Stadt bezwang, die Kreuze von den Kirchen riß und sie durch den
goldenen Halbmond ersetzte. Aus dem oströmischen Konstantinopel ward
Istambul, die Hauptstadt des osmanischen Reiches. Der Prophet aus der
arabischen Wüste verdrängte den Gottessohn aus Nazareth, und die
wenigen Christen der Riesenstadt leben in bitterer Bedrängnis. Ihnen
beizustehen in all ihrer Not, hat Pater Josef von Leonissa seine
umbrische Heimat verlassen.
Am Goldenen Horn wirft das Schiff mit dem venezianischen Löwenbanner
die Anker. Sein Reisebündel in der Hand, schreitet der Sohn des
heiligen Franziskus über die Galatabrücke, vorbei an den riesigen
Getreidemagazinen des Hafens, zwängt sich durch die von geschäftigem
Leben brausenden Gassen des Basars, in dessen Kaufgewölben sich alle
Schätze der Erde stapeln, Datteln aus Alexandrien, Seide und kostbare
Teppiche aus Samarkand und Buchara, Juwelen aus Persien, Gold aus
Indien, Gewürze aus dem heiligen
Mekka.
Der Ordensmann, der dem betäubenden Lärm zu entkommen trachtet,
verliert sich bald in ein Gewirr schmutziger Gassen, von denen manche
so eng sind, daß kaum mehr ein Handkarren durchkommt. Unter den
Girlanden hundertmal geflickter Wäschestücke tummeln sich mit lautem
Geschrei unzählige Kinder mit Hunden und Katzen. Der Geruch von Unrat,
Armut und Elend, der die flimmernde Luft erfüllt, legt sich beklemmend
auf die Brust.
«Das ist die Kehrseite von Istambul», sagt Pater Josef zu dem wackeren
Laienbruder Gregor, der neben ihm herstapft. «Für die Nase nicht gerade
ein Labsal!» lächelt sein Begleiter. «Wüßten wir nur, wie wir zu
unserem Klösterlein nach Pera kommen!» «Wir müssen uns nordwärts
halten, hat man mir bei der Abreise gesagt.» «Aber wo ist hier Norden?
In diesen abscheulichen Kloaken kann man die Sonne nicht sehen, nach
der man sich orientieren könnte.» «Leider kann ich kein Wort türkisch,
sonst würde ich fragen!» seufzt der Priester.
Wie sie noch unschlüssig Umschau halten, steht plötzlich ein kleines
Mohammedanerbüblein vor ihnen, mustert die Männer in den braunen
Kutten, sagt ein paar Worte, die sie nicht verstehen, faßt schließlich
den Pater bei der Hand und führt sie durch ein Gewirr von Gassen und
Straßen, bis es endlich auf ein unscheinbares Haus neben einem
christlichen Kirchlein deutet. Das helle Bürschlein hat ihren
Ordenskleidern angesehen, wohin sie wollen.
Pater Josef drückt ihm eine Nickelmünze in die schmutzige Hand; der
Junge wirft sie vor Freude jubelnd in die Luft, fängt sie geschickt
wieder auf und läuft davon.
Die Wanderer sind am Ziel. Herzlich heißen die beiden schon früher nach
Istambul gekommenen Ordensbrüder, die Patres Peter vom Kreuz und Dionys
von Rom, die Reisemüden willkommen. Nach einem bescheidenen Mahl sitzt
man noch lange in eifrigem Gespräch beisammen. Pater Josef erzählt aus
der Heimat, während die Mitbrüder über ihre Arbeit in Istambul
berichten. Ob es viele Christen in der Stadt gebe, will Pater Josef
wissen.
«In unserem Stadtteil Pera gibt es nur noch siebzehn christliche
Familien, meist europäische Kaufleute und Handwerker. Um so mehr
Glaubensbrüder werden Sie dafür in den Baracken am Hafen finden, wo man
die Galeerensträflinge zusammenpfercht, bis man sie an die Ruderbänke
schmiedet. Und schließlich gibt es noch Tausende getaufter Christen im
Enderun.» «Enderun? Was ist das?» «Enderun heißt
Strenge Schule. Sie liegt im dritten Hof des kaiserlichen Palastes»,
erklärt Pater Dionys. «Dort werden die künftigen Hofpagen und
Janitscharen erzogen.» «Und das sind Christen?» fragt Pater Josef
verblüfft.
«Die meisten gewiß! Zum größten Teil gehören sie zu den
'Tributkindern'. Alle drei Jahre fordert der Sultan von den
unterworfenen Völkerschaften dreitausend Knaben als Tribut. Manche
kommen auch von den Sklavenmärkten in Lemnos und Kaffa. Es sind Kinder
aus aller Herren Länder darunter, Albanier, Serben, Georgier,
Tscherkessen, Griechen, sogar Kroaten und Deutsche. Wer in diese Schule
aufgenommen wird, der bekommt einen neuen Namen und muß alle
Familienbande für immer lösen. Wenn sich das Tor des Enderun hinter ihm
geschlossen hat, darf er es nicht mehr durchschreiten, es sei denn zum
Bogenschießen auf den Höhen beim Friedhof oder im Gefolge des Sultans.
«Zwingt man sie, ihren Glauben aufzugeben?» «Das gerade nicht! Aber wie
sollen diese unglücklichen Kinder ihr Christentum bewahren, wenn sie
ohne jede seelsorgerische Betreuung aufwachsen? Bedenken Sie, daß sie
meist erst acht Jahre zählen, wenn man sie nach Istambul
schleppt!»
«Und es gibt keinen Weg zu ihnen?» «Sancta simplicitas!» lacht Pater
Petrus. «Wie denken Sie sich das? Diese Kinder sind von der Außenwelt
peinlicher abgeschlossen als die Kartäuser. Enderun ist das strengste
Kloster, das sich denken läßt.» «Wenn das ein Kloster ist, hausen darin
gewiß alle Teufel der Hölle», brummt Pater Dionys. «Man erzieht die
künftigen Janitscharen zu unerbittlicher Härte und kalter
Gefühlslosigkeit gegen sich und andere. Mit ihnen haben die Sultane
ihre größten Siege errungen.» «Nun, die Tage Suleimans des Prächtigen
sind vorüber», wirft Pater Petrus ein. «Unser gegenwärtiger Sultan
Murad III. vertrödelt die Zeit mit seinen Haremsdamen, Eunuchen,
Zwergen und Gauklern und fühlt sich in den Gärten des Serails wohler
als auf dem Schlachtfeld. Das Osmanische Reich verfällt immer mehr, und
das alte Wort bewahrheitet sich: 'Wenn der Türke aus dem Sattel steigt,
um sich auf einen Teppich zu setzen, so ist er ein Nichts - ein
Nichts!'» Pater Josef hört kaum zu, immer muß er an die unglücklichen
Kinder denken, denen niemand helfen kann. Um so mehr ist er
entschlossen, wenigstens den christlichen Galeerensträflingen
beizustehen.
Bald wandert er täglich von seinem Hospiz in Pera zum Hafenviertel,
verschafft sich Zutritt zu den Baracken, tröstet die unglücklichen,
verzweifelten Menschen, auf die die Hölle der Galeere wartet, pflegt
ihre Wunden, beugt sich mit wahrer Heilandsliebe über die Kranken und
Sterbenden. Für sie bettelt er an den Türen der Reichen, schleppt in
einem großen Sack seine Gaben - Brot, Wein und Früchte — in die Bagnos
und verteilt sie unter die Hungernden und Dürstenden.
Oft verläßt er erst zu später Stunde seine armen Schützlinge, und
einmal geschieht es, daß er sich in der Dunkelheit der Nacht
hoffnungslos verirrt. Bergauf, bergab steigt er über die ausgetretenen
Stufen der Gassen, ohne einen Ausweg zu finden. Es ist schon
Mitternacht, als er endlich bei einem Schuppen anlangt, in dem er
todmüde den Morgen abzuwarten gedenkt. Aber o Schreck! Er hat sich
ausgerechnet in eine Geschützremise verirrt. Als er das Tor öffnet,
setzt ihm ein Soldat seinen krummen Säbel auf die Brust und fragt, ob
er vielleicht eine Kanone stehlen wolle. Da der Kapuziner kaum ein paar
Worte türkisch spricht, vermag er sich nicht verständlich zu machen.
Der Soldat alarmiert die Wache, die den Eindringling fürchterlich
verprügelt und ins Gefängnis wirft.
Ein paar Wochen verbringt er in seinem elenden, schmutzigen Kerker, in
den kaum ein Lichtstrahl dringt, vermag mit dem verschimmelten Brot und
dem Schluck fauligen Wassers, das ihm ein mürrischer Wärter reicht,
kaum Hunger und Durst zu stillen, und träumt davon, recht bald als
Märtyrer sterben zu dürfen. Doch wird er auf Vermittlung des
venezianischen Gesandten schließlich freigelassen.
Im folgenden Jahr sucht eine fürchterliche Gottesgeißel die Stadt am
Bosporus heim. Die Pest geht um in Istambul und fordert entsetzliche
Opfer. In allen Häusern liegen Kranke und Sterbende. Auf hochbeladenen
Karren fährt man die Toten zum Friedhof. Männer, Frauen und Kinder
brechen auf offener Straße zusammen, verenden im Rinnstein. In den
engen Gassen der Armenviertel steht schwer und beklemmend der Atem der
Verwesung.
Am schlimmsten wütet die Seuche in den Bagnos der Galeerensklaven. Kaum
noch verläßt Pater Josef die Unglücklichen, sucht, wenn er sonst nicht
helfen kann, wenigstens ihre Seelen mit Gott zu versöhnen und ihnen ihr
schweres Sterben zu erleichtern. Als er nach Wochen, zu Tode erschöpft,
in das Hospiz zurückkehrt, teilt ihm Bruder Gregor weinend mit, daß
auch die beiden Patres Dionys und Petrus vom Kreuz der Seuche erlegen
sind.
Pater Josef hat keine Zeit, sich zu erholen. Am nächsten Morgen ist er
schon wieder unterwegs, liest die Kranken aus dem Straßenschmutz auf,
trägt sie ins Hospiz, pflegt sie mit dem guten Bruder, so gut er es
vermag, versieht die sterbenden Christen, tauft manchen Mohammedaner in
der Stunde des Todes.
Was Wunder, daß auch ihn die Seuche erfaßt! Todkrank erwartet er sein
Ende, aber seine starke Natur überwindet die Krankheit. Kaum genesen,
schleppt er sich wieder in die Bagnos, zumal gerade an diesem Tag eine
Galeere mit Ruderern bemannt werden soll. Er begleitet die
unglücklichen Sklaven bis ans Schiff. Einer von ihnen, ein Bursche von
etwa zwanzig Jahren, klammert sich an ihn und schreit, am ganzen Leibe
zitternd: «Helfen Sie mir, Vater! Retten Sie mich!»
Der Kapuziner kennt den jungen Mann von Bagno her, weiß, wie
verzweifelt er sich nach der Freiheit sehnt, um seiner armen Mutter
beistehen zu können, die in ihm ihren einzigen Ernährer hat. Zum
äußersten Opfer entschlossen, bietet er sich selbst als Stellvertreter
für den jungen Sträfling an, aber der Kapitän der Galeere betrachtet
den von der schweren Krankheit entkräfteten Mann mit spöttischer
Verachtung und antwortet lachend: «Was soll ich mit einem Knochengerüst
wie dir? Denkst du, ich könnte mit Invaliden meine Galeere
rudern?»
Verzweifelt muß der Priester zusehen, wie man den jungen Mann mit seinen Unglücksgefährten an die Ruderbank kettet.
Bald nach dieser Enttäuschung belohnt ihn Gott mit einer besonderen
Freude. In einem Palast, in dem er einige christliche Diener besuchen
will, trifft er den Hausherrn, einen vornehmen Pascha, an der Pest
erkrankt.
Aus Angst vor dem Schwarzen Tod haben alle Diener das Haus verlassen.
Völlig hilflos findet der Kapuziner den Siechen auf seinem
Lager.
Als verstehe sich das von selbst, pflegt er nun selbst den Pascha,
wäscht seine Wunden, reicht ihm zu essen und zu trinken, wacht bei ihm
in den Nächten. «Warum tun Sie das alles für mich?» fragt der Kranke,
als er sich eines Morgens ein wenig wohler fühlt. «Gewiß erwarten Sie
eine gute Bezahlung.» «Ich will nichts, als Ihnen helfen», antwortet
der Kapuziner. «Das ist meine Pflicht als Christ und als
Priester.»
Lange schweigt der Sieche, dann sagt er leise: «Auch ich war einst ein
Priester, nicht ein römischer wie Sie, sondern ein Priester der
griechischen Kirche. Aber der Ehrgeiz nach Ämtern und Würden verleitete
mich, meinem Glauben zu entsagen und die Religion des Propheten
anzunehmen.» «Mein armer, armer Bruder!» sagt Pater Josef erschüttert.
«Alle haben mich verlassen, seit mich die Pest niedergeworfen hat»,
stöhnt der Pascha. «Meine Frauen, meine Kinder, meine Dienerschaft.»
«Gott hat Sie nicht verlassen, obschon Sie sich von ihm abkehrten»,
antwortet der Kapuziner mit tiefem Ernst. «Wenn Sie meine Hilfe nicht
verschmähen, will ich Sie in seine Arme zurückführen; denn er steht
neben Ihrem Lager und wartet auf Sie.»
Wenige Tage später versöhnt sich der gefallene Priester durch eine
reumütige Beicht mit Gott. Nach seiner Seele gesundet endlich unter der
großmütigen Pflege des Minderbruders auch sein Leib. Ein Gedanke läßt
den frommen Kapuziner nicht mehr los, raubt seinen Nächten den Schlaf,
der Gedanke an die armen Knaben im Enderun. Als er wieder einmal
schlaflos auf seinem armen Lager ruht, faßt er einen tollkühnen
Entschluß. Er will zum Sultan, um von ihm die Erlaubnis zu erbitten,
den gefangenen Schülern als Seelsorger beizustehen.
Inbrünstig fleht er am anderen Morgen beim heiligen Opfer um Mut und
Kraft zu seinem Vorhaben. Dann macht er sich auf den Weg zum
kaiserlichen Palast am Bosporus.
«Entweder bist du ein Narr oder betrunken», lachen die wachhabenden
Janitscharen, als er verlangt, vor den Sultan geführt zu werden. Wie er
aber versucht, ohne ihre Genehmigung einzudringen, packen sie ihn am
Bart, reißen ihn zu Boden und jagen ihn nach einer tüchtigen Tracht
Prügel davon.
«Die Stunde scheine ich schlecht gewählt zu haben», seufzt der
Kapuziner, als er zerschlagen davonhumpelt. «Ich muß eine bessere
finden.» Einige Tage später versucht er sein Wagnis aufs neue. Diesmal
wählt er die heißeste Stunde des Tages und findet, wie er es hoffte,
die Soldaten beim äußersten Tor, der Hohen Pforte, neben der Trommel
eingenickt.
«Die Disziplin scheint sich auch bei den Janitscharen zu lockern, seit
der Sultan den Sattel mit dem Teppich vertauscht hat», murmelt er vor
sich hin und stiehlt sich an den Wachen vorbei in den ersten Hof. Auch
beim zweiten Tor findet er die Posten schlafend. Beim dritten aber, das
zu durchschreiten jedem Unbefugten unter Todesstrafe verboten ist,
ergeht es ihm übel.
Schon sieht er in dem weiten Hof das Enderun, die Kaserne der künftigen
Pagen und Janitscharen, als ihn ein Posten erwischt und ihn zornig
fragt, wie er hereingekommen sei. «Durchs Tor!» erwidert gelassen der
Mönch. «Ich bitte dich, führe mich zum Sultan, ich habe etwas Wichtiges
mit ihm zu besprechen!» Der Soldat aber schleppt ihn zur Wache, wo ihn
der Offizier wie ein Wundertier anstarrt. Dann packt man ihn und wirft
ihn ins Gefängnis. «Nun wird es mit dir zu Ende gehen, mein Freund»,
flüstert sich der fromme Mann selber zu. «Bist gerade dreiunddreißig
Jahre alt, wie unser Herr, als man ihn ans Kreuz schlug. In Gottes
Namen denn! Es ist das Schlechteste nicht, als Märtyrer zu enden. Ob du
aber die Palme der Blutzeugen verdienst, ist eine andere Sache; denn
wenn der Papst von deinem Narrenstreich hört, wird er vielleicht
duchaus nicht sehr erbaut sein.»
Nach vielen Tagen öffnet sich kreischend die Tür zu seinem Kerker. Ein
Gerichtsbeamter tritt ein und verkündet ihm das Urteil. Zur Sühne für
seinen Frevel soll er «halbgekreuzigt» werden. «Warum nur halb und
nicht ganz wie mein lieber Herr?» fragt der Kapuziner überrascht. Aber
schon packen ihn die Fäuste der Henker und führen ihn zum
Richtplatz.
Mit inniger Freude sieht der Priester den Galgen, von dessen Querbalken
zwei Ketten mit eisernen Haken herabhängen. Der Henker durchbohrt die
linke Hand und den rechten Fuß, treibt die Haken hinein und läßt den
Verurteilten in der glühenden Sonnenhitze am Galgen
hängen.
Ein entsetzlicher Schmerz durchflammt die Glieder des Gefolterten. Die
erbarmungslose Glut der Sonne quält ihn unbeschreiblich, jeder Nerv
brennt wie im Feuer. Die Sinne vergehen ihm. Als man ihn endlich löst,
träumt er wie im Fieber.
Es ist ihm, als sähe er einen holdseligen Knaben, der ihn mit einem Lächeln vom Schandholz befreit.
Ein paar Christen tragen ihn ins Hospiz, wo er ohnmächtig auf sein
Lager niedersinkt. Als er endlich genesen ist, befiehlt ihm der Obere,
nach Italien zurückzukehren, da er befürchtet, der gute Ordensgenosse
möchte durch ähnliche Narrenstreiche die ganze Mission gefährden.
Schweren Herzens fügt sich Pater Josef, geht aufs Schiff und sieht die
Stadt am Bosporus im Dämmern des Tages entschwinden. Als Volksmissionar
in seiner umbrischen Heimat beschließt er nach schwerer Krankheit am 4.
Februar 1612 bei Sonnenaufgang sein Leben.
(aus: Hünermann, Wilhelm: "Geschichte der Weltmission" 2. Bd., Luzern/München 1960, S. 12 ff.) |