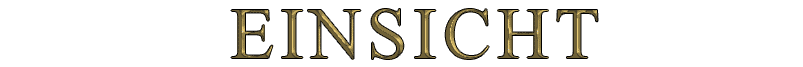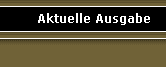DIE HL. HELENA
Kaiserin, + ca 330
von
Eugen Golla
Helena gehört zu den großen Frauengestalten der Zeit des beginnenden
Verfalls des Imperium Romanum. Für uns, die wir auf genaue Datierungen
und Informationen eingestellt sind, bleibt bedauerlicherweise vieles
über ihr Leben im Helldunkel nur selten klarer, meist aber ungenauer,
sich widersprechender und legendär gefärbter Berichte. Schon bezüglich
ihrer Herkunft und des Geburtsortes sind wir auf Wahrscheinlichkeiten
angewiesen. Die früher bisweilen vatretene Ansicht, sie sei die Tochter
eines kleinen britischen Königs gewesen, ist heute überholt. Fast
allgemein wird nunmehr die am Bosporus in der römischen Provinz
Bithynien gelegene Stadt Drepanum, die später ihr Sohn Konstantin der
Große ihr zu Ehren in Helenopolis umbenannte, als Geburtsort
bezeichnet. Als Geburtsjahr kann etwa 250 angenommen werden, also jene
Zeit, in der unter Kaiser Decius die erste systematisch betriebene
Christenverfolgung ausgebrochen war. Aus ärmlichen Verhältnissen
kommend, soll sie Gastwirtin oder Kellnerin gewesen sein, bevor sie der
römische Offizier Konstantius, der sich von ihrer Schönheit bezaubern
ließ, zur Frau nahm. Es muß sich um eine morganatische Ehe, d.i. eine
Ehe "zur linken Hand", gehandelt haben, denn ihre Abstammung versperrte
gemäß den Satzungen des Römischen Rechtes den Weg zu einer vollwertigen
Ehe.
Um das Jahr 275 wurde Helena die Mutter des späteren Kaisers Konstantin
d.Gr. Im Jahr 284 bestieg Diokletian, ein tüchtiger und tatkräftiger
Mann, den Kaiserthron. Er wollte das Römische Reich in seiner früheren
Stärke wiederherstellen, indem er unter Abschaffung der äußerlich noch
bestehenden Formen der Republik eine unumschränkte Regierung von vier
Herrschern - zwei Oberkaisern, den Augusti, und zwei Hilfskaisern, den
Cäsaren - einführte. Obwohl selbst von niederer Herkunft, gelang es
Konstantius, schnell zu hohen Würden zu gelangen, um schließlich 293
Cäsar, d.h. Mitregent des Augustus Maximian zu werden und als solcher
die Provinzen Gallien, Spanien und Britannien zur Verwaltung zu
erhalten. Da opferte der ehrgeizige Mann seine Frau der hohen Politik:
Konstantius verstieß seine Frau Helena, um die Stieftochter seines
Augustus, Theodora, zu heiraten. Helena ertrug diese bittere Schmach
mit Geduld und lebte in Zurückgezogenheit. Das änderte sich aber, als
im Jahre 3o6 Konstantius starb und unter Ausschluß der Söhne aus seiner
zweiten Ehe Konstantin zu seinem Nachfolger eingesetzt hatte. Dieser,
der seine Mutter innig liebte, suchte nun ihr das von seinem Vater
zugefügte Unrecht möglichst wiedergutzumachen. So wurde sie, die bisher
am Hofe zwar geduldet, aber ohne Rechte und Ehrungen war, durch die
Zuerkennung des Titels "Noblissima femina" in den Adelsstand erhoben.
Auch schenkte der Sohn seiner Mutter in seiner Residenzstadt Trier
einen eigenen Palast.
Die Macht Konstantins wurde vergrößert, als er des Augustus Maximian
Sohn Maxentius, der in Rom eine tyrannische Herrschaft aufgerichtet
hatte, vor den Toren der Ewigen Stadt an der Milvischen Brücke
besiegte. Dieser Triumph, der Jesus Christus zugeschrieben wurde -
trugen doch die Schilde und Feldzeichen in Konstantins Heer das
Christus-Monogramm - leitete eine neue Ära im römischen Weltreich ein:
den Sieg des Kreuzes über das Heidentum.
Jetzt sind wir an dem Punkte angelangt, wo wir uns die Frage stellen
müssen, wann Helena die heilige Taufe empfing. Auch hier widersprechen
sich die Quellenangaben. Fest steht nur, daß dieses Ereignis nicht
später als Konstantins Sieg über Maxentius angesetzt werden darf. Aber
der Historiker muß weiter fragen: Wurde Helena durch Konstantin
Christin oder bekehrte die Mutter den Sohn? Ernest Hello schreibt dazu:
"Es ist ein Gesetz der Geschichte, daß jedes Ereignis durch eine Frau
seinen Anfang nimmt. Die Frau gewinnt den Mann für eine Sache, die Frau
gibt Leben oder Tod. Es entspricht der Natur der Dinge, daß Helena den
Konstantin gewonnen hat. Die Ereignisse gehen scheinbar vom Mann aus,
aber sie gehen in Wirklichkeit von der Frau aus. Das trifft besonders
zu für die religiösen Ereignisse."
Nach dem Sieg über Maxentius verlegte Konstantin, nunmehr alleiniger
Herrscher über den abendländischen Teil des Römischen Reiches, seine
Residenz nach Rom. Helena zog mit ihm und erhielt als Wohnsitz das
Sessorium, einen nicht weit vom Lateran - wo die erste christliche
Kirche errichtet wurde - gelegenen Palast mit weiträumigen Wohn- und
Repräsentationssälen. Der Kaiser erhob nun seine Mutter auch zur Würde
einer Augusta, d.i. einer Kaiserin. Aber nicht dieser Glanz, sondern
Gebet und Werke der christlichen Nächstenliebe prägten das Leben der
hl. Helena. Auch besteht kein Zweifel, daß die aus der Finsternis der
Katakomben befreite Kirche in ihr hinsichtlich Kirchenbauten,
Wiedergutmachung und Glaubensförderung die mächtigste und eifrigste
Förderin besaß.
Ganz anderer Natur war Konstantin. Er machte seinem Namen, der erste
christliche Kaiser gewesen zu sein, nicht die Ehre, die man hätte
erwarten können. Letztlich blieb er immer nur ein halber Christ, und es
ist daher ein tiefgründiges Symbol, daß sein Bildnis - die 1670 von
Bernini errichtete Reiterstatue - nicht im Inneren des Petersdoms,
sondern in dessen Vorhalle ihren Platz erhalten hat. Bald nach dem
Konzil von Nicäa (325) brach Helena zu einer Reise in das Heilige Land
auf. Wenn auch das Verlangen, die Orte, wo Christus gelebt und gelitten
hatte, kennen zu lernen und vielleicht auch begnadet zu werden, das
Heilige Kreuz, welches seit dem Tode Christi verschollen war,
wiederaufzufinden, die Hauptmotive waren, dürfte wohl auch ein Drama,
das sich im engsten Familienkreis abgespielt hatte, die schon
75-jährige bewogen haben, das noch überwiegend heidnische Rom
wenigstens für eine gewisse Zeit zu verlassen: Ihr Lieblingsenkel
Crispus, der Sohn aus Konstantins erster Ehe, war von seiner
Stiefmutter, der Kaiserin Fausta, eines Majestätsverbrechens angeklagt
worden, worauf er, der unschuldig war, zum Tode verurteilt wurde.
Helena deckte den Betrug auf, worauf Konstantin Fausta ohne
gerichtliches Verfahren in den Thermen des kaiserlichen Palastes
ersticken ließ.
Obwohl Helena eine Reiseequipage, ebenso Ortslexika, Karten und
Wegebeschreibungen, sog. Itinierarien, zur Verfügung standen, war die
Fahrt über den Balkan und Zypern nach dem Hafen Tyros langwierig und
anstrengend. Schwere Zeiten waren über Palästina, wo sich das
Christentum in den auf den Tod und die Auferstehung und die Himmelfahrt
folgenden Zeiten auszubreiten begann, hinweggegangen. Nachdem sich die
Juden 135 nochmals gegen die Römerherrschaft erhoben hatten, wurde
Jerusalem zerstört. Auf seinen Trümmern ließ der Kaiser Hadrian eine
Kolonistenstadt, die den Namen Älia Capitolina erhielt, gründen.
Gleichzeitig befahl er, die Heiligtümer der Christen tief mit Erde zu
überschütten und darauf Stätten des Götzendienstes, z.B. auf dem
Kalvarienberg einen Venustempel und in Bethlehem eine
Adonis-Kultstätte, zu errichten.
Obwohl die noch verbliebenen Gläubigen nun gezwungen waren, diese
Stätten, die ab da der Anbetung heidnischer Götter, deren Mysterien,
d.h. unter anderem auch der Ausschweifung dienten, voll Abscheu zu
meiden, wurde von Geschlecht zu Geschlecht überliefert, was im Boden
verborgen liegt. Es bedurfte daher nur des Befehls Konstantins, die
heidnischen Kultstätten niederzureißen und das Erdreich fortzuschaffen.
Bald konnte der Grundstein für die großartige erste Grabeskirche gelegt
werden, die 614 von den Persern zerstört wurde.
Ein schier unermeßliches Betätigungsfeld eröffnete sich so für Helena,
die mit entsprechenden Vollmachten ihres Sohnes sowie der kaiserlichen
Kasse ausgestattet war. Allerorts wurde ihr gehuldigt, und sie wurde
außerdem mit Bitt- und Gnadengesuchen überschüttet. Sie ließ auf dem
Ölberg und in der Nähe der Geburtastätte des Heilandes in Bethlehem
Gotteshäuser errichten, von denen das letztgenannte, eine fünfschiffige
Basilika, bis auf unsere Zeiten im wesentlichen in seiner
ursprünglichen Gestalt erhalten blieb. Es wird überliefert, daß die
Kaiserin nicht nur Armen und Gefangenen half und wie eine einfache
Christin die bescheidenen Bethäuser besuchte, sondern daß sie auch die
gottgeweihten Jungfrauen bei Tische bediente und Dienste leistete,
welche bisher allein der verachteten Klasse der Sklaven vorbehalten
waren. Schließlich gewährte ihr Gott die Erfüllung ihres sehnlichsten
Wunsches: Gemäß des Berichtes des hl. Ambrosius suchte sie im
Felsgelände auf dem Kalvarienberge nach dem unter dem Schutt begrabenen
Kreuz Christi. Plötzlich stießen die Arbeiter auf drei Kreuze. Das
mittlere mußte gemäß der Berichte der Evangelien dasjenige Christi
sein. Aber der Pergamentstreifen, der Bruchstücke lateinischer,
griechischer und hebräischer Worte erkennen ließ, lag lose daneben. Da
fand der Patriarch von Jerusalem, der hl. Makarios, folgende Lösung: er
gebot dem umstehenden Volk zu beten und Schwerkranken, die Kreuze zu
berühren. Während sich bei den zwei ersten nichts ereignete, erfolgten
beim Berühren des dritten Wunderheilungen, welche von verschiedenen
Gewährsmännern und Heiligen bezeugt wurden. Ein großes Stück vom
Heiligen Kreuz überließ Helena dem Kaiser, der daraufhin ein Gesetz
erließ, das künftig das Kreuzigen von Verbrechern verbot.
Bald nach ihrer Rückkehr starb Helena, wahrscheinlich 330 in
Konstantinopel, nach den Berichten des Bischofs Eusebios von Cäsarea in
Gegenwart ihres großen Sohnes, der ihr zur Seite stand, sie pflegte und
ihre Hände in den seinen hielt. Die sterblichen Überreste wurden nach
Rom überführt und mit den für eine Kaiserin vorbehaltenen Ehrungen im
Familienmausoleum beigesetzt. Im 9. Jahrhundert gelangten ihre
Reliquien angeblich in die Abtei Hautvillers in der Diözese Reims, eine
Kopfreliquie wird im Dom zu Trier aufbewahrt. In der bildenden Kunst
wird die hl. Helena mit den Attributen der Kaiserwürde dargestellt,
bisweilen aber auch an den heiligen Stätten das Kreuz tragend. Zwei
Städte sind besonders reich an Erinnerungen an sie: Rom und Trier. In
der Ewigen Stadt ist es vor allem die Kirche Santa Croce in
Gerusalemne, von deren ursprünglichen Bau, der anstelle ihres Palstes
errichtet wurde, noch die Außenmauern stehen. Das ehrwürdige
Gotteshaus, das zu den sieben Hauptkirchen Roms gehört, an deren Besuch
reiche Ablässe verbunden sind, birgt neben anderen Reliquien bedeutende
Partikel vom Kreuze Christi sowie Fragmente der Kreuzesinschrift.
Bischof Matthias Eberhard von Trier, der mutige Bekenner in der Zeit
des Kulturkampfes und einer der großen Kanzelredner des vorigen
Jahrhunderts, bezeichnete die hl. Helena in einer seiner Predigten als
"Pflegerin, Mutter und Amme der trierischen Kirchen". Diese Worte haben
sicherlich geschichtliche Grundlagen: weilte doch Konstantin als Kaiser
oft in Trier und ihr Lieblingsenkel, der auf so tragische Weise
umgekommene Crispus, residierte dort seit 315. Nach der Tradition war
es auch Helena, die den heiligen Rock der dortigen Domkirche schenkte.
Fest: der 18. August.
BENÜTZTE LITERATUR:
Völkl, Ludwig: "Der Kaiser Constantin" München 1957.
Hello, Ernst: "Heiligengestalten" Köln & Ölten 1953.
Stadler, J. Ev.: "Vollständiges Heiligen-Lexikon in alphabet. Ordnung" Augsb. 1861.
"Vies des Saints", Paris 195o, Band 8.
Wetzer und Weite: "Kirchenlexikon" Freiburg 1888, 5. Band.
|