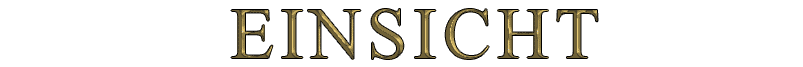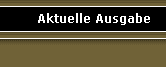DER HL. PHILIPP NERI
von
Eugen Golla
Er ist nicht nur der Apostel Roms, sondern auch dessen volkstümlichster
heiliger. Sein Heimatland aber war die an Rebhängen und Olivenhainen so
reiche Toskana, sein Geburtsort das stolze, herrliche Florenz. Der 1515
als Sohn eines Notars geborene Philipp verbrachte einen Teil seiner
Jugend als Zögling des berühmten Dominikanerklosters San Marco, in dem
etwa 3o Jahre vor Philipp Savonarola gelebt und gewirkt hatte.
Scheinbar besteht der denkbar größte Gegensatz zwischen dem harten,
humorlosen, von Pessimismus geprägten Bußprediger und dem
liebenswerten, heiteren, an Mutterwitz so reichen Neri. Aber beiden war
eine tiefe, von Sittenstrenge geprägte Frömmigkeit und Gottesliebe
gemeinsam sowie das Verlangen, Mißstände in der Kirche zu beseitigen,
so daß Savonarolas Schriften zu Philipps Lieblingslektüre gehörten.
Sein Vater, der sich ständig in Geldnöten befand und der schließlich in
der Alchemie sein Glück zu finden hoffte, war froh, als sich ein
reicher kinderloser Onkel, der in dem südlich von Rom gelegenen San
Germano lebte, bereit erklärte, den jungen Mann in seinem
Kaufmannsgeschäft auszubilden und als Erben einzusetzen. Philipp aber
hatte an Handelsgeschäften keine Freude. Um so mehr liebte er dagegen
die stille Betrachtung. Bald hatte er den Plan gefaßt, auf die
Erbschaft von 22000 Skudi zu verzichten und San Germano wieder zu
verlassen. Sein Wunsch war es, ein Leben in Armut zu führen - ähnlich
wie der hl. Franziskus v. A. vor ihm. Sein Ziel war Rom, das sich nur
allmählich von den furchtbaren Zerstörungen des Jahres 1527, vom sog.
"Sacco di Roma", d.i. der Eroberung und Plünderung durch die Söldner
Karls V., zu erholen begann.
Philipp hatte das Glück, bald nach seiner Ankunft in der Ewigen Stadt
einen reichen Landsmann namens Caccia kennenzulernen. Er nahm dessen
Angebot an, gegen Überlassung eines elenden Mansardenzimmers und eines
Malters Mehl pro Jahr die Erziehung seiner zwei Knaben zu übernehmen.
16 Jahre lebte Philipp so unter denkbar ärmlichen Verhältnissen, wobei
er die ihm zur Verfügung stehende Freizeit vor allem dazu benützte, in
den sieben Hauptkirchen Roms oder in der Katakombe bei San Sebastian,
der einzigen, die damals zugänglich und nicht von Schutt und Erde
verschüttet war, zu beten. In diesen unterirdischen Grabkammern war es
auch, wo seine mystischen Zustände, die ihm beim Gebet eine brennende
Flamme in seiner Brust fühlen ließen, schließlich ihren Höhepunkt
erreichten: sein ungestüm pochendes Herz hob zwei Rippen nach außen,
ohne einen Schmerz zu verursachen. Nicht nur der Arzt, der die Sektion
vorgenommen hatte, veröffentlichte hierüber einen Bericht, sondern auch
andere Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts gaben hierüber Gutachten ab.
Neris lebhaftes Wesen, seine Liebe zu Gott und seinen Mitmenschen
blieben nicht unberührt von den Ansätzen zu einem neuen Leben in der
Kirche. Eine tiefgreifende Erneuerung des Katholizismus war wegen des
mit ungestümer Kraft vorwärts drängenden Protestantismus mehr denn je
erforderlich. Der damalige Papst Paul III. - teil noch Repräsentant der
verweltlichten Renaissancezeit - stellte sich den Anforderungen einer
wahrhaft umfassenden Reform. Als herausragende Maßnahmen, die er
deswegen ergriff, seien erwähnt die Ernennung würdiger Kardinale, die
Bestätigung der Gesellschaft Jesu sowie die Eröffnung des Konzils von
Trient.
Es drängte daher den jungen Mann, der wie ein Eremit lebte, einen
Beitrag zur sittlichen Erneuerung Roms zu leisten. Anfangs übernahm er
den Dienst in den Spitälern, bald aber dehnte er sein Apostolat auch
auf die Straßen aus. Sein stets freundliches Wesen, seine von Schwulst
und Pathos freien Reden bewirkten, daß ihm viele ihre Sorgen
anvertrauten oder gar ihren Glauben wiederfanden.
1548 verband sich Philipp mit 15 einfachen Leuten zur Gründung einer
Bruderschaft zur Heiligen Dreifaltigkeit, deren Aufgabe es sein sollte,
mittellose Rompilger sowie Rekonvaleszenten zu betreuen.
Er überlegte sich, ob es nicht besser sein würde, wenn er seine
Missionen als Priester durchführen würde, da ein Priester ein von der
Kirche beauftragter Diener Gottes ist, der auch Autorität qua Amt
hätte. Deshalb begann er mit dem Studium der Theologie und Philosophie,
doch in seiner Zurückhaltung und Bescheidenheit ließ er sich erst nach
längerem Drängen durch seinen Beichtvater bewegen, im Jahre 1551, als
er also schon 36 Jahre alt war, sich zum Priester weihen zu lassen. Als
Kleriker war er in der Tat imstande, sein Apostolat mit noch weit
größerem Erfolg auszuüben. Vor allem widmete er sich oft - manchmal bis
zu 15 Stunden am Tag - dem Beichthören. Von seiner Zelebration der hl.
Messe wird berichtet, daß er es nicht nur tief ergriffen, häufig unter
Tränen tat, sondern daß er bisweilen in eine Ekstase verfiel, daß seine
Bewegungen derart impulsiv wurden, daß die Stufen des Altares erbebten.
Überliefert wird auch eine Episode von drei Juden, die zunächst
hartnäckig seinen Bekehrungsversuchen widerstanden, bis er eine hl.
Messe für sie las. Als sie beendet war, baten die Juden um die Taufe.
Philipp Neri predigte nicht wie üblich in den Kirchen, sondern er
versammelte immer mehr Menschen in seinem Zimmer, unter ihnen auch sehr
gebildete Personen, um mit ihnen über religiöse Dinge zu sprechen.
Ähnlich wie später der hl. Don Bosco oder der hl. Klemens Maria
Hofbauer verstand er es auch, Kinder und Jugendliche um sich zu
sammeln. Ja, er legte für sie sogar einen Spielplatz an. Als er einmal
gefragt wurde, wie er die lärmende Ausgelassenheit ertragen könne,
antwortete er: "Mögen sie meinetwegen Holz auf meinem Rücken hacken,
wenn sie nur nicht sündigen." Zugleich sorgte er aber auch dafür, daß
seine Schützlinge geistig gefordert wurden, hielt er ihnen doch vor,
daß es im Paradies keine Faulpelze gäbe. Er verlangte daher von den
Jugendlichen, daß sie den Umgang mit den Armen und Gefangenen
kennenlernen und den Kranken erbettelte Lebensmittel bringen sollten.
Zur Popularität Philipps in Rom trug auch die Wiederbelebung der
Wallfahrte zu den sieben Hauptkirchen Roms in der Karnevalszeit oder an
den Ostertagen durch ihn bei. Während es anfangs nicht mehr als ca. 2o
Teilnehmer waren, wuchs im Laufe der Jahre die Teilnehmerschar auf
mehrere Tausend an.
Philipp Neri war von Natur aus ein heiterer Mensch, der um sich
Freundlichkeit verbreitete und Wärme. Doch es wäre verfehlt, in ihm
einen Priester zu sehen, der nicht auch harte Forderungen hätte stellen
können. Einer seiner Grundsätze war es, die Selbstsucht, den Stolz und
die Menschenfurcht zu besiegen und sich in Demut zu üben. Eine dieser
Demutsübungen bestand darin, sich öffentlich bewußt lächerlich zu
machen, indem man mit halbrasiertem Bart durch die Straßen gehen mußte
oder sich abenteuerlich zu kostümieren hatte oder wie ein Clown oder
Mime herumpromenieren mußte, der an einem Blumenstrauß herum roch. Bei
Neri taten diese Clownerien, mit denen er sich demütigen wollte, seiner
priesterlichen Würde keinen Abbruch. Zu diesen Übungen gehörte es
jedoch auch, daß er seine mystischen Begabungen vor den anderen
verheimlichte. Und er war im höchsten Grade mißtrauisch gegenüber
anderen Personen, wenn sie ihm von Visionen und Privatoffenbarungen
berichteten; denn wichtiger sei es, so Philipp Neri, die eigene
Selbstsucht zu bezwingen und die Fehler seiner Mitmenschen mit Geduld
zu ertragen.
Neben der seelsorgerischen Arbeit machte sich Philipp Neri zusammen mit
seinen Schülern und Anhängern auch auf den Gebieten von Kunst und
Wissenschaft sehr verdient. Als die Zahl seiner Anhänger auf einige
Hundert angewachsen war, entschloß er sich, die Zusammenkünfte in einer
Kapelle über dem Schiff der Kirche San Girolamo delle Carita zu
verlegen, der er den Namen "Oratorium" gab, eine Bezeichnung, welche
bald auch auf die Zusammenkünfte übertragen wurde. Diese bestanden aus
einem stillen Gebet, einer Lesung, einem Vortrag über ein Thema aus der
Hl. Schrift, den Kirchenvätern oder der Kirchengeschichte. Ein Gebet
und ein Gesang bildeten den Abschluß der Zusammenkünfte. Die zu den
Festtagen besonders feierlich vorgetragenen Gesänge - ihr Ausgangspunkt
waren volkstümliche geistliche Lieder, deren Text theologisch
paraphrasiert wurde - sollten die Musik den geistlichen Übungen
dienstbar machen, d.h. diese Gesänge sollten zu Buße und Nächstenliebe
aufrufen. Dieser pädagogische Hintergrund bildete den Keim für die
nachfolgend ausgebildete musikalische Gattung des sog. Oratoriums, das
mit seiner freien Dichtung nach biblischen Stoffen in Versen und die
Aufteilung auf Chor und Solisten - ähnlich wie in der Oper - im 18. und
19. Jahrhundert, insbesondere durch Händel, Mendelssohn und Liszt,
seinen Höhepunkt als musikalische Gattung erreichen sollte.
Zwischen den Jahren 1559 und 1574 waren die Magdeburger "Zenturien"
erschienen, eine großangelegte Kirchengeschichte aus protestantischer
Sicht, die in einem polemischen Ton nachweisen wollte, daß es dem
Antichristen gelungen sei, die Religion des Evangeliums und der
Urkirche, die der Auffassung Luthers voll und ganz entsprochen hätte,
so zu verdunkeln, daß Luther hätte kommen müssen, um sie
wiederherzustellen. Die katholische Kirche, die sich, besonders in
Deutschland, nur unter äußerster Kraftanstrengung gegen den Ansturm der
neuen Lehre behaupten konnte, hatte anfangs erhebliche Schwierigkeiten,
diesem Werk eine adäquate Widerlegung entgegenzusetzen. Philipp Neri
fand jedoch unter seinen Schülern einen befähigten Gelehrten: Cesar
Baronius, ein unscheinbar wirkender Priester, der aus den Abruzzen
stammte und sich ihm frühzeitig angeschlossen hatte. Neri beauftragte
Baronius mit dieser Arbeit, obwohl dieser lieber eine Abhandlung über
ein Thema aus der Dogmatik verfaßt hätte. 1579 erschien der erste Band
seiner "Annales ecclesiastici", von denen der Verfasser bekannte, daß
Neri aufgrund seines Studiums, seiner Initiative und seiner
Aufmunterung der eigentliche Urheber sei.
Auch die Wiederentdeckung der Katakomben im 16. Jahrhundert ist zum
großen Teil auf die Bemühungen Neris zurückzuführen, der es verstand,
seine Anhänger für das christliche Altertum zu begeistern.
Im Jahre 1575 wurde die Kongregation des Oratoriums gegründet, wodurch
das eigentliche Lebenswerk Philipp Neris eine autorisierte und feste
Grundlage erhielt. Die Gründung wurde vom Papst bestätigt, der der
Kongregation die Kirche Santa Maria in Vallicella samt allen Rechten
und Einkünften übergab. Weil die Kirche baufällig war, ließ sie Neri
abreißen und an ihrer Stelle eine neue errichten, welche dann den
Beinamen "Chiesa Nuova" erhielt. Neri erlebte nur die ersten zehn Jahre
der Bauarbeiten der neuen Kirche, die mit ihrem großartigen und
prunkvoll dekorierten, dreischiffigen Inneren zu den berühmteren
Kirchen der Ewigen Stadt zählen sollte. Neri selbst siedelte später in
das neben der Vallicella errichtete Domizil über. Der heilige Philipp
Neri, in manchem das Gegenteil des hl. Ignatius von Loyola, wollte an
der Spitze seiner religiösen Genossenschaft keinen Ordensgeneral, nach
ihm sollten sogar die einzelnen Oratorien auch organisatorisch
voneinander völlig unabhängig sein. Doch diesem Wunsch wurde nicht
stattgegeben. Für Neri machte man insofern eine Ausnahme, daß er 1587
zum gemeinsamen Vater der Kongregation ernannt wurde.
Im hohen Alter wurden ihm viele Ehrungen zuteil. Mehrere Päpste boten
ihm die Kardinals- und Bischofswürde an, die er in seiner
Bescheidenheit hartnäckig ausschlug, wobei er, wenn er allzu sehr
gedrängt wurde, sicherlich auch zu skurrilen Ausflüchten gegriffen
haben mag. In besonderem Ansehen stand er bei Papst Klemens VIII., den
er durch die Berührung seiner Hände von der Gicht geheilt hatte. Seit
diesem Ereignis küßte Klemens VIII. bei jeder öffentlichen Begegnung
Neri die Hände. Ja, man sagte sogar, mit Klemens VIII. habe der Gründer
der Oratorianer den päpstlichen Thron bestiegen.
Ein schweres kirchenpolitisches Problem bestand anfangs der neunziger
Jahre des 16. Jahrhunderts für den Stuhl Petri darin, ob man dem neuen
König Frankreichs, Heinrich IV. von Navarra trauen könne hinsichtlich
seiner religiösen Einstellung. Obwohl Heinrich längst trotz aller
Widerstände der mit Spanien sympathisierenden Liga Herr Frankreichs
geworden, wartete er dennoch vergeblich auf seine Lossprechung vom
Rückfall in die Ketzerei. Daß sich schließlich Klemens VIII. dennoch
zur Absolution des "Hugenottenkönigs" entschloß - wodurch die
Voraussetzung für die Beseitigung des kirchlichen Notstandes in
Frankreich geschaffen war -, ist nicht zuletzt auf Neris Fürsprache
zurückzuführen.
Philipp starb achtzigjährig an den Folgen eines Blutsturzes am 26. Mai
1595. Bereits zwei Monate nach seinem Tod wurde seine Seligsprechung
eingeleitet. Aber Klemens VIII. ging bei der Kanonisation sehr
sorgfältig und gründlich vor. Wenn er es auch anfangs erlaubte, daß
aufgrund der vielen Wunder, die man Philipp zuschrieb, auf seinem Grab
Votivtafeln angebracht wurden, verbot er es schließlich doch, solange
die Kirche nicht ein authentisches und autoritatives Wort gesprochen
habe. Die Heiligsprechung erfolgte dann sehr schnell: bereits 1622
erhob ihn Papst Gregor XV. zur Ehre der Altäre. Des hl. Philipp Neris
Fest wird am 26. Mai gefeiert. Seine letzte Ruhestätte fand der Heilige
in einer Seitenkapelle der Kirche S. Maria Vallicella.
Literaturhinweise:
Adler, Guido: "Handbuch der Musikgeschichte" 2. Band, München 1975.
Feldmann, Christian: "Gottes sanfte Rebellen" Freiburg 1984.
Hello, Ernest: "Heiligengestalten" Leipzig 1934.
Kranz, Gisbert: "Engagement und Zeugnis" Regensburg 1977.
Pastor Papstgeschichte, Bd.9/11.
|