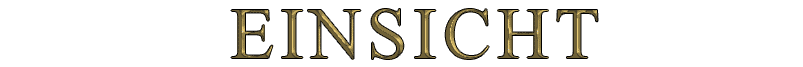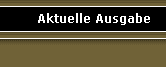Gegen die Heiden
- Auszug aus dem ersten Jugendwerk des hli. Athanasius -
Zu den Frühwerken des heiligen Athanasius von Alexandria zählt das Buch "Contra Gentiles" (Gegen die Heiden). In diesem Werk, das eigentlich "Gegen das Heidentum" betitelt sein müßte, zeigt der große Kirchenlehrer, wie die Menschheit, die ursprünglich den wahren Glauben besaß, aus eigener Bosheit zunächst sittlich verfiel, sich dann Idole schuf und schließlich Irrlehren ersann, in die sie sich zunehmend verirrte.
Zusammen mit "De incarnatione verbi" (Über die Menschwerdung des Wortes), dem zweiten Buch des Heiligen, stellt es eine großartige Verteidigungsschrift für das Christentum dar. Sicherlich noch vor dem nicänischen Konzil, vermutlich um 320, entstanden, erweist es seinen etwa 25jährigen Autor auch als guten Kenner - und damit als überzeugenden Kritiker - der heidnischen Mythologie, die zu dieser Zeit zwar seit wenigen Jahren nicht mehr Staatsreligion, aber noch immer zugelassen und allgemein verbreitet war.
An dieser Stelle wollen wir einen Auszug aus dem Werk wiedergeben, das in seinen Grundzügen auch als Modell für den heutigen Glaubensabfall großer Teile der einstmals katholischen Welt dienen kann.
***
Im Anfange gab es keine Bosheit, und sie findet sich ja auch jetzt nicht bei den Heiligen; ja für sie existiert sie überhaupt nicht. Erst später sind die Menschen auf sie verfallen und begannen, sie zu ihrem eigenen Verderben weiterzubilden. So bildeten sie sich denn auch eine Vorstellung von Idolen und dachten sich das Nichtseiende als wirklich. Gott, der Schöpfer der Welt und Allbeherrscher, der über jedes Wesen und jede menschliche Vorstellung erhaben ist, hat in seiner Güte und überreichen Liebe durch seinen eigenen Logos, unseren Heiland Jesus Christus, das Menschengeschlecht nach seinem eigenen Bilde erschaffen und den Menschen in seiner Verähnlichung mit sich zum sinnigen und verständigen Betrachter der Dinge bestellt. Er gab ihm auch Begriff und Kenntnis von seiner eigenen Ewigkeit, damit er in demselben Urzustand verharre, nie von seiner Gottesvorstellung abfalle, noch auch vom Umgang mit den Heiligen sich lossage, vielmehr im Besitze der Gnade des Gebers und seiner eigenen Kraft, die vom väterlichen Logos stammt, freudig mit Gott verkehre und ein ungetrübtes und wahrhaft seliges, unsterbliches Leben führe. Denn nichts steht ihm hindernd auf dem Weg zur Erkenntnis des Göttlichen, und so schaut er in seiner eigenen Unversehrtheit immerdar das Bild des Vaters, den Logos Gottes, nach dessen Ebenbild er auch geschaffen ist. Ja, er gerät außer sich vor Bewunderung, wenn er dessen Vorsehung im Weltall betrachtet; er erhebt sich über alles Sinnenfälltige und jede körperliche Vorstellung und tritt mit der göttlichen, geistigen Welt im Himmel in Verbindung in der Kraft seines Geistes. Wenn nämlich der menschliche Geist nicht mit dem körperlichen sich abgibt und auch keinerlei Beimischung von der daraus entspringenden Begierlichkeit von außen erhält, vielmehr ungeteilt ist, in erhabener Höhe mit sich selbst beschäftigt, wie er im Anfange gewesen, ja, dann schreitet er über die Sinnenwelt und alles Menschliche hinaus, schwebt in der Höhe, sieht den Logos und schaut in ihm auch den Vater des Logos, voll Entzücken ob seiner Anschauung und in immer neuem Verlangen nach ihm. So hat ja der erste Mensch, der in der Sprache der Hebräer auch Adam genannt ward, nach Angabe der heiligen Schriften zu Anfang in harmloser Freiheit mit Gott geistigen Umgang gepflogen und mit den Heiligen zusammengelebt in der Betrachtung der geistigen Welt, der er an jener Stätte oblag, die auch der heilige Moses bildlich Paradies nannte. In ihrer Reinheit ist aber die Seele dazu fähig, Gott in sich selbst wie in einem Spiegel zu schauen, wie auch der Herr sagt: "Selig, die reinen Herzens sind, sie werden Gott anschauen" [Mt. 5,8].
So also hat der Schöpfer, wie gesagt, das Menschengeschlecht ausgestattet, und so sollte es nach seinem Willen bleiben. Doch die Menschen schätzten das Bessere gering, waren säumig in dessen Ergreifung und suchten mehr das, was ihnen näher lag. Näher aber lag ihnen der Körper mit seinen Sinnen. So wandten sie ihren Geist vom Geistigen ab und begannen sich selbst zu betrachten. Aber in der Betrachtung ihrer selbst, beschlagnahmt vom Körper und der übrigen Sinnenwelt und hier gleichsam daheim sich wähnend, verfielen sie der Begierde nach sich selbst und zogen das Ihrige der Betrachtung des Göttlichen vor. Indem sie aber darin verweilten und von dem, was näher lag, nicht lassen wollten, gaben sie ihre von allerlei Begierden verwirrte und verunreinigte Seele den körper-lichen Lüsten gefangen; schließlich vergaßen sie der ihnen ursprünglich von Gott verliehenen Kraft. Man kann das schon beim ersten erschaffenen Menschen bewahrheitet sehen laut dem, was die heiligen Schriften von ihm erzählen. Auch er blieb, solange er seinen Geist auf Gott und dessen Betrachtung richtete, abgewandt von der Betrachtung seines Körpers. Als er aber auf Anraten der Schlange seine Gedanken von Gott ablenkte und sich zu betrachten anfing, da verfielen sie alsbald auch der sinnlichen Lust, erkannten, daß sie nackt waren, und schämten sich nach erwachter Erkenntnis. Sie erkannten aber ihre Nacktheit nicht so fast im Mangel an Kleidung, sondern weil sie der Betrachtung des Göttlichen verlustig gegangen waren und ihre Gedanken auf das Gegenteilige gerichtet hatten. Denn abgefallen von der Betrachtung des Einen und Wahren, nämlich Gottes, und von der Liebe zu ihm, ergaben sie sich jetzt den verschiedenen Begierden des Leibes und seinen Trieben. Und, wie es zu geschehen pflegt, von der gelegentlichen und vielfachen Befriedigung der Lust kam es bei ihnen auch zur entsprechenden Gewohnheit, so daß sie gar in Furcht lebten, ihnen entsagen zu müssen. So kam denn auch feige Angst und Furcht, Vergnügungssucht und vergäng-liches Trachten in die Seele. Denn weil sie sich von den Lüsten nicht trennen will, fürchtet sie den Tod und die Trennung vom Leibe. Weil sie aber für ihre Begehrlichkeit wieder nicht das Ent-sprechende fand, so lernte sie morden und Unrecht tun. Wie sie aber hierbei zu Werke geht, darf wohl nach Kräften gezeigt werden.
Nachdem die Seele von der Betrachtung des Geistigen abgekommen war und die einzelnen Kräfte des Körpers mißbraucht, an der Betrachtung des Leibes sich ergötzt und in der Lust ein Gut für sich gefunden haue, mißbrauchte sie in ihrem Wahne das Wort und glaubte, die Lust sei das wahre Gut selbst, ähnlich einem geistig Verrückten, der ein Schwert verlangte wider die, die ihm begegnen, und dabei meinte, weise zu handeln. Die Lust aber einmal liebgewonnen, begann die Seele, sie auf mannigfache Weise zu erregen. Denn von Natur sehr beweglich, treibt sie nach ihrer Abkehr vom Guten immer weiter. Sie bewegt sich nun zwar nicht mehr in der Richtung der Tugend und so, daß sie Gott schaute, sondern sie hängt am Nichtseienden, gibt ihrer Fähigkeit eine andere Richtung und mißbraucht sie zu Lüsten, die sie ersonnen, da sie ja frei geboren ist. Sie kann wie dem Guten zustimmen, so auch vom Guten sich abkehren. Wendet sie sich aber vom Guten ab, dann denkt sie notwendig an seine Kehrseite. Denn sie kann nicht zu absoluter Ruhe kommen, weil sie, wie vorhin bemerkt, von Natur sehr beweglich ist. Und im Bewußtsein ihrer Freiheit erkennt sie, daß sie die Glieder des Leibes in zweifacher Richtung gebrauchen kann, für das Seiende sowohl wie für das Nichtseiende. Das Seiende ist aber das Gute, das Nichtseiende das Böse. Wesenhaft aber nenne ich das Gute, sofern es sein(e) Urbild(er) im wahrhaft seienden Gott findet. Nichtseiend aber nenne ich das Böse, weil es, ohne wirklich zu sein, nur menschlichem Sinnen entsprungen ist. Denn obschon der Körper Augen hat, um die Schöpfung zu sehen, aus ihrer vollen Harmonie den Schöpfer zu erkennen, obschon er auch ein Gehör hat, um die göttlichen Offenbarungen und die Gebote Gottes zu vernehmen, obschon er auch Hände hat, um die notwendige Arbeit zu leisten und beim Gebet sie zu Gott zu erheben, so kehrte sich die Seele doch ab von der Betrachtung des Guten und dem Leben in ihm und treibt jetzt in ihrem Wahne in entgegengesetzter Richtung. Denn als sie ihrer Fähigkeit, wie schon gesagt, inne wurde und sie dann auch mißbrauchte, kam sie darauf, daß sie die Glieder des Leibes auch in entgegengesetzter Richtung bewegen könnte. Und deshalb wendet sie das Auge, anstatt auf die Schöpfung zu schauen, auf Begierden und zeigt so, daß sie auch hierzu imstande ist, wobei sie glaubt, ihre Würde zu bewahren, wenn sie nur einmal tätig sei, und nicht zu sündigen, wenn sie tue, was sie könne. Und sie begreift nicht, daß sie nicht zur Bewegung überhaupt, sondern zu zweckmäßigem Leben erschaffen ist. Deshalb mahnt ja auch die Stimme des Apostel: "Alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt" [1. Kor. 6,12].
Allein die Verwegenheit der Menschen sah es nicht auf das Nützliche und Geziemende ab, sondern zielte nach dem Möglichen und begann, in entgegengesetzter Richtung tätig zu sein. So führte sie die Hand zu widernatürlichem Tun und ließ sie morden, verführte das Ohr zum Überhören und die anderen Glieder zum Ehebruch anstatt zu rechtmäßiger Kindererzeugung, die Zunge statt zur Segnung zu Lästerung, Schmähung und Meineid, die Hand wieder zu Diebstahl und Mißhandlung der Nebenmenschen, den Geruchsinn zur Aufnahme mannigfacher erotischer Gerüche, die Füße zu raschem Blutvergießen, den Bauch zu Trunkenheit und unersättlicher Schlemmerei, was lauter Missetaten und Sünden der Seele sind. Die Schuld daran liegt aber nirgends anderswo als in der Abkehr vom Besseren. Denn wie ein Wagenlenker, der auf der Rennbahn das Gespann besteigt, aber auf das Ziel nicht achtet, dem er zufahren soll, von diesem vielmehr ablenkt und das Roß überhaupt nur leitet, wie er es gerade kann - er kann es aber leiten, wie er will - oft auf die ihm Begegnenden stößt, oft auch über Abhänge stürzt und da anlangt, wohin ihn die Hitze der Rosse führt, und dabei noch meint, bei solchem Laufe das Ziel nicht verfehlt zu haben - er sieht ja nur auf den Lauf, ohne darauf zu achten, ob er vom Ziel abgekommen ist -, so kommt auch die Seele zum Falle, die vom Wege zu Gott sich abkehrt und die Glieder des Leibes zu Ordnungswidrigem veranlaßt oder gar auch selbst mit ihnen sich instinktiv leiten läßt; und sie gestaltet sich selbst das Böse, ohne wahrzunehmen, daß sie vom Wege abgeirrt ist und fern vom Ziel der Wahrheit steht, das der Christusträger, der selige Paulus, im Auge hatte, wenn er sagte: "Ich verfolge das Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus" [Phil. 3,14]. So auf das Gute achtend, tat der Heilige nie das Böse.
Einige Heiden, die vom Wege abirrten und Christum nicht kannten, haben sich zwar dahin aus-gesprochen, daß das Böse als Substanz und an und für sich existiere. Damit irrten sie im einen wie im anderen Falle: sei es, daß sie den Schöpfer nicht als den Urheber des Seienden gelten lassen - denn er wäre nicht Herr des Seienden, wenn ja, wie sie meinen, das Böse an sich Existenz und Wesenheit hätte -, oder da sie andernfalls, wenn sie ihn Schöpfer aller Dinge sein lassen, ihn not-wendig auch als Urheber des Bösen erklären - wohl offenbar ungereimt und unmöglich. Denn das Böse kommt nicht vom Guten, ist nicht in ihm, noch durch dasselbe. Das Gute könnte doch nicht mehr gut sein, wenn es eine Mischnatur wäre oder Quelle von Bösem. Die Häretiker freilich, die von der kirchlichen Lehre abgefallen sind und im Glauben Schiffbruch gelitten haben, sie faseln ja auch von einer Substanz des Bösen und stellen sich außer dem wahren Vater Christi einen zweiten Gott vor, und zwar als ungewordenen Schöpfer des Bösen und Urheber der Bosheit wie als Gründer der Schöpfung. Doch diese sind leicht zu widerlegen sowohl aus den göttlichen Schriften wie auch aus der menschlichen Vernunft selbst, laut der sie auch mit diesen Vorstellungen zu den Wahnwitzigen gehören. So sagt zur Bekräftigung der Worte Mosis unser Herr und Heiland Jesus Christus in seinen Evangelien: "Gott der Herr ist einer" [Mk. 12,29; Deut. 6,4], und: "Ich preise Dich, Vater, Herr Himmels und der Erde" [Mt. 11,25]. Wenn aber Gott einer ist, und dieser der Herr Himmels und der Erde, wie kann es neben diesem einen zweiten Gott geben? Und wo wird auch dieser ihr Gott sein, wenn der Eine und Wahre im Umkreis des Himmels und der Erde alles erfüllt? Wie könnte auch ein anderer der Schöpfer dessen sein, worüber nach dem Worte des Heilandes Gott selbst und der Vater Christi der Herr ist? Sie müßten denn im Sinne einer Gleichsetzung sagen, der Herr des guten Gottes könne auch der böse Herr sein. Aber wenn sie das behaupten, dann sieh, in welche Gottlosigkeit sie fallen! Bei gleich Mächtigen kann man doch keinen Vorrang oder Vorzug entdecken. Wenn nämlich das eine gegen den Willen des anderen ist, so liegt bei beiden die gleiche Macht und Ohnmacht: gleiche Macht, weil sie mit ihrer (bloßen) Existenz den beiderseitigen Willen überwinden, gleiche Ohnmacht, weil die Dinge auch ohne und gegen ihren Willen ihren Lauf nehmen. Denn es existiert der Gute wider den Beschluß des Bösen, und es besteht der Böse gegen den Willen des Guten.
Übrigens kann man ihnen auch noch folgendes vorhalten: Wenn das Sinnenfällige ein Werk des Bösen ist, wo ist dann das Werk des Guten? Denn in die Erscheinung tritt einzig und allein nur die Schöpfung des Baumeisters. Wo ist dann noch ein Wahrzeichen für die Existenz des Guten, wenn keine Werke von ihm da sind, aus denen man ihn erkennen könnte? Aus den Werken erkennt man doch den Meister. Doch wie könnte es überhaupt auch zwei einander entgegengesetzte Existenzen geben, bzw. worin liegt das sie scheidende Moment, so daß sie gesondert voneinander existieren können?
Gleichzeitig können sie ja nicht existieren, weil sie sich gegenseitig aufheben. Auch kann keine in der anderen sein wegen der Unvereinbarkeit und Ungleichheit ihrer Natur. So wird das trennende Moment von einem Dritten herkommen, und das wäre auch Gott. Doch welche Natur wird dies Dritte haben, die des Guten oder die des Bösen? Das wird dunkel bleiben. Unmöglich kann es die Natur beider haben. Da so nun diese ihre Anschauung sich als töricht herausstellt, so muß die Wahrheit, wie sie in der kirchlichen Lehre liegt, Licht bringen. Danach kämmt das Böse nicht von Gott, noch ist es in Gott, noch ist es von Anfang dagewesen, noch ist es irgendeine Substanz, vielmehr begannen die Menschen in Ermangelung der Vorstellung vom Guten sich auszudenken und einzubilden, was nicht ist und ihnen beliebt. Denn wie einer, der bei Sonnenschein und bei Beleuchtung der ganzen Erde durch das Sonnenlicht die Augen schlösse und sich eine Finsternis vorstellte, obschon eine solche nicht bestünde, und dann gleichsam im Dunkel irrend herumginge, oft hinfiele und in Abgründe stürzte, im Wahne, es wäre nicht Licht, sondern Finsternis - er meint ja zu sehen und sieht doch absolut nicht -, so hat auch die menschliche Seele ihr Auge geschlossen, mit dem es Gott schauen kann, und sich das Böse vorgestellt, in dem sie sich herumtreibt, und weiß nicht, daß sie nur etwas zu tun wähnt, (in Wahrheit) aber nichts leistet; denn sie bildet sich das Nichtseiende ein. Sie blieb auch nicht so, wie sie gewesen ist, sondern zeigt sich jetzt in der Befleckung, die sie selbst verschuldet hat. Denn sie ist erschaffen worden, um Gott zu schauen und von ihm erleuchtet zu werden. Doch sie hat nicht Gott, sondern das Vergängliche und die Finsternis gesucht, wie irgendwo auch der Geist Gottes urkundlich sagt: "Gott hat den Menschen recht erschaffen; sie aber strebten nach einer Allerwelt-weisheit" [Eccl. 7,30]. Das war also der Ursprung und die Entwicklungsgeschichte des Bösen bei den Menschen. Wie sie dann auch in den wahnwitzigen Götzendienst herabgesunken sind, davon muß nunmehr die Rede sein, damit du erkennest, daß die Erfindung der Götzen durchaus nicht vom Guten, sondern vom Bösen ausgegangen ist. Was aber im Prinzip schlecht ist, kann wohl nie irgendwie für gut befunden werden, da es absolut schlecht ist.
Nicht genug daran, die Bosheit ersonnen zu haben, begann die menschliche Seele, nach und nach in noch Schlechterem sich auszuwirken. Sie lernte verschiedene Arten von Lüsten kennen, zog über sich her den Schleier der Vergessenheit für das Göttliche, ergötzte sich an den fleischlichen Regungen, sah nur mehr auf das Augenblickliche und dessen Reize und verfiel so auf den Wahn, es gebe außer dem Sichtbaren nichts weiteres mehr, vielmehr sei das Zeitliche und Leibliche das Gute. Aber abgekehrt und verlustig gegangen des Bewußtseins, ein Ebenbild des guten Gottes zu sein, sieht sie jetzt nicht mehr mit der ihr eigenen Kraft Gott den Logos, nach dem sie erschaffen ist; vielmehr macht sie, außer sich gekommen, sich Gedanken über das Nichtseiende und stellt es sich vor. Denn mit dem Wust der sinnlichen Begierden hat sie gleichsam den Spiegel in sich verdeckt, in dem allein sie das Bild des Vaters schauen konnte, und sieht jetzt nicht mehr, woran die Seele zu denken hat; vielmehr treibt sie sich überall herum und sieht nur, was in die Sinne fällt. Deshalb stellt sie sich, trunken vor lauter fleischlicher Begier und betäubt von ihren Vorspiegelungen, nunmehr den Gott, den sie im Herzen vergessen hatte, in körperlichen und sinnlichen Dingen vor, indem sie den Namen Gott auf die sichtbaren Dinge überträgt und nur das preist, was ihr beliebt und was sie willkommen findet. Voraus geht also dem Götzendienst als dessen Quelle die Bosheit: Erst verstanden es die Menschen, sich die nichtseiende Bosheit auszudenken, dann schufen sie sich auch die nichtseienden Götter. Wie einer, der in die Tiefe stürzte und bei seiner Blickrichtung nach unten und kraft des ihm nachstürzenden Wogenschwalles das Licht nicht mehr sähe noch das im Lichte Sichtbare, und jetzt, wo er nur das in der Tiefe Liegende wahrnimmt, wähnte, es gebe außer dem nichts weiteres, sondern eben dem ihm Sichtbaren komme die Herrschaft über das Seiende zu, so haben auch vor Zeiten die törichten Menschen, versunken in die fleischlichen Begierden und Vorstellungen und verlustig gegangen ihres Gottesbegriffes und Gottesglaubens, ihrer verfinsterten Vernunft oder vielmehr Unvernunft folgend, die sichtbaren Dinge als Götter sich gedacht, erhoben so die Kreatur über den Schöpfer und erwiesen lieber den Werken göttliche Verehrung als ihrem Urheber und Schöpfer, Gott dem Herrn.
Wie aber nach dem vorhin angeführten Gleichnis die in die Tiefe Sinkenden, je weiter sie abwärts gleiten, in um so dunklere und tiefere Stellen geraten, so ist es auch dem Menschengeschlechte ergangen. Denn sie hielten nicht an einem Götzendienst fest, blieben nicht bei dem stehen, womit sie begonnen, sondern solange sie noch bei den ersten Verirrungen verweilten, gingen sie schon auch auf neuen Teufelsspuk aus. Und weil sie an den ersten nicht satt wurden, füllten sie sich mit neuem Bösen an, kamen so in den schändlichsten Dingen immer weiter und erschlossen ihrer Gottlosigkeit immer weiteres Gebiet. Dafür zeugt auch die göttliche Schrift, wenn sie sagt: "Wenn der Gottlose in den Abgrund der Bösen gerät, dann achtet er es nicht" [Sprichw. 18].
Kaum war nämlich der menschliche Geist von Gott abgekommen, da sanken die Menschen in ihrer Einsicht und in ihrem Urteil und übertrugen die Gott schuldige Ehre zuerst auf den Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne, und sie hielten diese Gestirne nicht nur für Götter, sondern auch für die Begründer der übrigen, zeitlich späteren Dinge. Dann sanken sie in ihrem verfinsterten Urteil noch tiefer und nannten den Äther, die Luft und die Erscheinungen in der Luft Götter. Noch weiter gingen sie im Bösen und priesen schon auch die Elemente und Urstoffe der Körperbildung, die Wärme, die Kälte, die Trockenheit und Feuchtigkeit als Götter. Wie aber die, die ganz hinfallen, nach Art der Erdschnecken auf der Erde kriechen, so haben die Gottlosesten unter den Menschen, nachdem sie gefallen und von der Vorstellung (des wahren) Gottes abgekommen waren, nunmehr Menschen und Gestalten von Menschen, sei es noch während ihres Lebens, sei es nach ihrem Tode unter die Götter versetzt. Ja, als ihr Sinnen und Trachten noch verkommener wurde, übertrugen sie gar auf Steine und Holzstöcke, auf Kriechtiere im Wasser und auf dem Land und auf unvernünftige wilde Tiere den göttlichen und überirdischen Namen Gottes, erwiesen ihnen alle göttliche Ehre und kehrten sich ab vom wahren und wahrhaft seienden Gott, dem Vater Christi. Aber wäre doch wenigstens die Verwegenheit der Toren hierbei stehen geblieben, und hätten sie sich doch nicht noch mehr erniedrigt und mit Gottlosigkeit befleckt!
Einige sanken ja geistig gar so tief, und ihr Verstand wurde so sehr verfinstert, daß sie sogar Dinge, die überhaupt nie und nirgends existieren und in der Welt vorkommen, gleichwohl sich einbildeten und zu Göttern erhoben. Sie vermischten vernünftige Wesen mit unvernünftigen, kombinierten naturverschiedene Dinge und verehren sie als Götter. Dahin gehören bei den Ägyptern die Götter mit Hunds-, Schlangen- und Eselsköpfen, bei den Libyern Ammon mit dem Widderkopf. Wieder andere nahmen die Körperteile: Haupt, Schulter, Hand und Fuß für sich gesondert, versetzten einen jeden unter die Götter und verehrten ihn göttlich, wie wenn sie nicht genug hätten an ihrem Kult für den ganzen, ungeteilten Körper. Andere treiben die Gottlosigkeit noch weiter: sie vergöttern und verehren den Lockruf zur Erfindung dieser Götter und zu ihrer eigenen Bosheit, die Lust und die Begierde. So liegt es bei ihrem Eros und der Aphrodite in Paphos. Andere bei ihnen erkühnten sich, als wollten sie sich in der Schlechtigkeit überbieten, ihre Regenten oder deren Kinder unter die Götter zu versetzen, bald aus Verehrung gegen die Herrscher, bald aus Furcht vor deren Tyrannei: Dahin zählen ihr hochberühmter Zeus auf Kreta, und der arkadische Hermes, bei den Indern Dionysos, bei den Ägyptern Isis, Osiris und Oros und jetzt Antinous, der Liebling des römischen Kaisers Hadrian, den sie wohl als einen Menschen kennen, und dazu als einen Menschen, der statt ehrwürdig zu sein voll Geilheit war, den sie aber doch verehren aus Furcht vor dem, der es gebot. Als nämlich Hadrian in Ägypten weilte, befahl er die Verehrung des verstorbenen Antinous, des Werkzeuges seiner Lust, weil er den Knaben auch nach dem Tode noch liebte - übrigens zugleich ein konkreter Beweis und das Zeugnis dafür, daß eben alle Idololatrie bei den Menschen nicht anderswie aufkam als auf dem Wege der Begierlichkeit auf seiten derer, die sie gestalteten, wie auch schon die Weisheit Gottes bezeugt: "Der Anfang der Unzucht ist die Erfindung der Götzen. [Weish. 14,121.]
Doch wundere dich nicht und halte das Gesagte nicht für so unglaublich, wo doch noch unlängst oder vielleicht bis in die Gegenwart herein der römische Senat die Regenten, die je einmal seit Anfang über die Römer geherrscht haben, alle oder in beliebiger Auswahl unter die Götter dekretiert und ihre göttliche Verehrung vorschreibt. Denen sie nämlich nicht gewogen sind, die geben sie als von Natur feindlich aus und nennen sie Menschen; die sie aber sympathisch finden, diese sollen wegen ihrer Tugend verehrt werden, als stünde es in ihrer Macht, Götter zu schaffen, sie, die doch selbst Menschen sind und ihre Sterblichkeit nicht leugnen können. Sie müßten aber, wenn sie Götter schaffen wollen, zuerst selbst Götter sein. Denn das erschaffende Prinzip muß höher stehen als das Ding, das gemacht werden soll: der Richter muß über dem stehen, den er richtet, und der Geber gibt jedenfalls nur, was er hat, wie auch jeder König nur verleiht, was er hat, und mächtiger und größer ist als der Empfänger. Wenn sie aber die als Götter kanonisieren, die sie haben wollen, so müßten sie erst selbst Götter sein. Doch das Auffallende daran ist, da sie als Menschen selbst auch sterben und damit ihren Beschluß über die von ihnen Vergötterten als trügerisch verwerfen.
Quelle: Dr. Stegmann, A. (Übersetzer) (1917). Des heiligen Athanasius Schriften Gegen die Heiden - Über die Menschwerdung. In: Des heiligen Athanasius ausgewählte Schriften II. Band. (Bibliothek der Kirchenväter, Band 31) O. Bardenhewer, T. Schermann und K. Weyman (Hrsg). Kempten, München, Kösel.
|